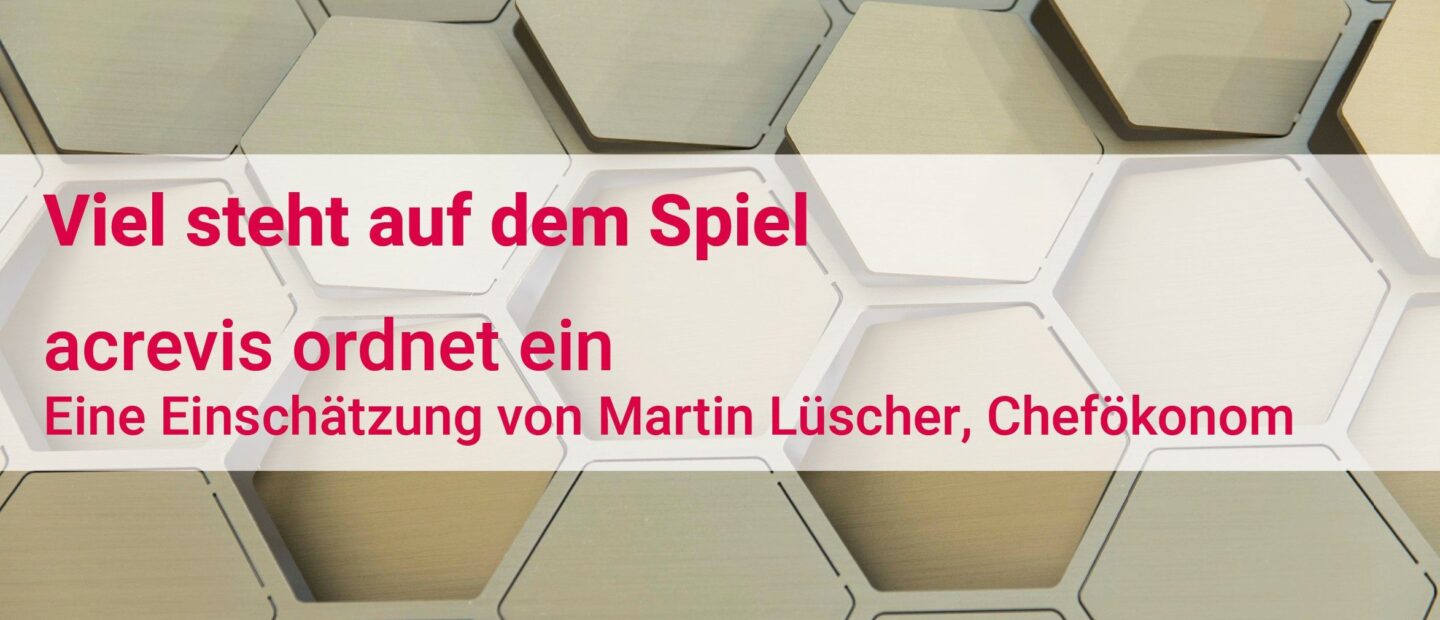
Von tektonischen Verschiebungen
Diesmal ist es anders – gefährliche Worte, klar. Doch die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen unterscheiden sich grundsätzlich von den Turbulenzen der vergangenen Dekaden: Tektonische Verschiebungen sind im Gange.
In meinen 18 Berufsjahren an den Finanzmärkten habe ich durchaus turbulente Zeiten erlebt. Teils bedeutend näher, als mir lieb war. Den Anfang machte die UBS: Im Herbst 2007 startete ich im Global Wealth Management im Research. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Investmentbank Bear Sterns bereits zwei Hedge Funds wegen sinkender Immobilienpreise liquidiert und in England stürmten Kundinnen und Kunden die Filialen des Finanzhauses Northern Rock – da waren sie, die Vorboten der Finanzkrise. Neuartige Produkte und verschachtelte Strukturen bündelten, mischten und verteilten die Risiken des US-Immobilienmarkts über die ganze Welt. Am Ende wusste niemand mehr, wo Gefahren schlummerten – und kein Finanzinstitut traute mehr dem anderen. Der Interbankenmarkt stand vor dem Kollaps. Dann ging es los: Einige Finanzhäuser gingen unter, andere wurden von Konkurrenten übernommen und weitere wurden vom Staat gerettet. Auch in der Schweiz: Eines Tages lief ich ins Büro und ein Kollege teilte mir mit, die UBS sei nun eine Staatsbank.
2009 wechselte ich zur Privatbank Wegelin & Co. Dort erlebte ich die Verlagerung des Epizentrums der Finanzkrise und hatte ein wenig erfreuliches Déjà-vu. Aus der US-Immobilienkrise wurde die Eurokrise. Zu den amerikanischen Schuldpapieren, die ihren Weg auch in europäische Bankbilanzen gefunden hatten, gesellten sich allzu hohe staatliche Ausgaben und Schuldenberge sowie ein starres Wechselkurssystem. Nun standen europäische Staaten vor dem Zusammenbruch. Besonders diejenigen der Peripherie: Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. Erneut mussten Währungshüter und Politiker rettend eingreifen – diesmal um Staatspleiten zu verhindern. Mehrheitlich mit Erfolg. Währenddessen ging Wegelin & Co. auf Konfrontationskurs mit der US-Regierung, verschätzte sich im Machtpoker aber fatal. Und von einem Tag auf den anderen war die Privatbank Wegelin & Co. Geschichte.

2020 folgte die Pandemie. In New York, nun als Korrespondent für die Schweizer Wirtschaftszeitung «Finanz und Wirtschaft» tätig, sass ich im Auge des Sturms. Der Times Square ausgestorben, Kühllaster vor Bestattungsunternehmen und über Wochen kaum sozialen Kontakt. Die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte und gar die Gesellschaft standen vor dem Kollaps. Wieder schritten Währungshüter und Politiker ein. Dank den in der Finanz- und Eurokrise erprobten monetären Rettungsmassnahmen und fiskalischen Unterstützungen blieb es bei einer schmerzhaften Delle, die allerdings nur temporär war: Die Konjunktur und auch die Finanzmärkte erholten sich rasch und setzten den langfristigen Aufwärtstrend fort.
1944, 1971 und 1973 lassen grüssen
Ein Finanzsystem, das zusammenzubrechen droht. Banken, die verschwinden. Staaten, die nur knapp den Bankrott vermeiden. Eine Teuerung, die fast ausser Kontrolle gerät. Dazwischen Rezessionen und ein Virus, das die Welt zum Stillstand bringt. Was könnte da noch überraschen?
Ganz einfach: tektonische Verschiebungen. Oder ein bisschen genauer: Systemwechsel. Denn im Gegensatz zu den Krisen der vergangenen Dekaden stehen derzeit ganze Systeme selbst zur Debatte oder werden sogar bereits abgelöst: die neoliberale Wirtschaftsordnung, der globale Freihandel, die rechtsstaatliche Demokratie, die Unabhängigkeit der Geldpolitik und damit auch der US-Dollar als Weltwährung. Was auf diese Systeme folgt, ist erst noch im Entstehen. Tiefgreifende Veränderungen zeichnen sich aber ab. Wie zur Einführung des Währungssystems Bretton Woods 1944 oder zum Ende des Goldstandards 1971 respektive 1973, als flexible Wechselkurse eingeführt wurden.

Diese tektonischen Verschiebungen betreffen nicht nur Supermächte und Weltmärkte. Sie wirken bis in den Alltag von Anlegerinnen und Anlegern, Eigenheimbesitzenden, Sparerinnen und Sparern oder Vorsorgenehmenden. Genau hier setzt meine Arbeit bei der acrevis Bank an. Seit drei Jahren bin ich nun hier tätig, neuerdings in der Funktion als Chefökonom.
Bedeutung auf der Spur
Die Frage liegt auf der Hand: Braucht eine Regionalbank aus dem Osten der Schweiz mit 57’000 Kundinnen und Kunden, 11’000 Aktionärinnen und Aktionären sowie 190 Mitarbeitenden einen Chefökonomen? Jemanden, der sich ausser dem täglichen Bankengeschäft mitunter um eben solche Systemwechsel Gedanken macht? Jemanden, der sich fragt, wie diese Veränderungen die Finanzmärkte und die Unternehmen beeinflussen? Jemanden, der herauszufinden versucht, was dies für Anlegerinnen und Anleger, für Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, für Sparerinnen und Sparer, für Vorsorgenehmerinnen und -nehmer bedeutet?
Die Fragen sind – selbstverständlich – rhetorisch. Die Antworten lauten: Ja, denn wer die grossen tektonischen Verschiebungen versteht, kann auch die richtigen Entscheidungen im Kleinen und Konkreten treffen.