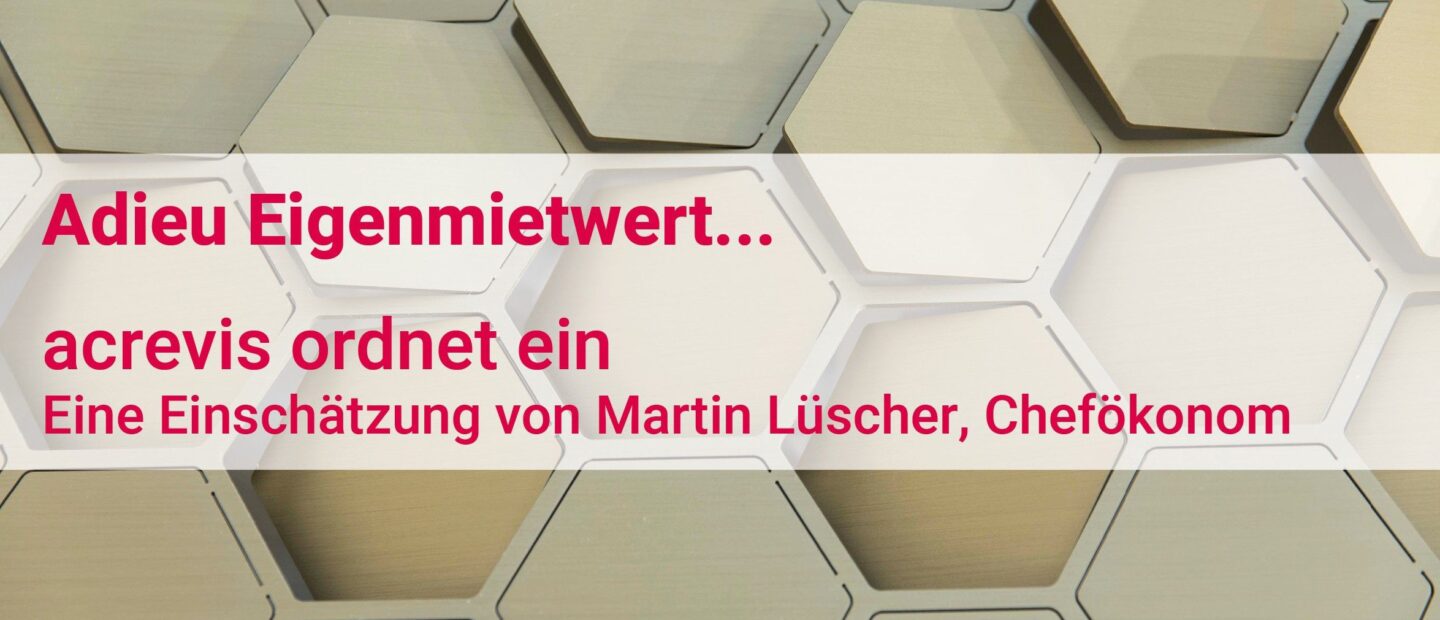
Das bedeutet das Ende des Eigenmietwerts
Das Volk hat entschieden: Der Eigenmietwert wird abgeschafft. Und damit auch die Abzugsmöglichkeit von Hypothekarzinsen und werterhaltenden Investitionen. Das hat Folgen für die Wirtschaft, den Immobilienmarkt und auch ganz konkret für bestehende und künftige Hypothekarkundinnen und -kunden.
Der Eigenmietwert ist Geschichte. Das haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schweiz am 28. September entschieden. Die Umsetzung findet laut der Bundespräsidentin Karin Keller Sutter wohl aber nicht vor 2028 statt. Genug Zeit also, um sich auf die neue Situation einzustellen.
Beim Eigenmietwert handelt es sich um eine Steuer. Wer seine Liegenschaft selbst bewohnt, muss den sogenannten Eigenmietwert als Einkommen versteuern. Der Eigenmietwert orientiert sich am Betrag, den der Eigentümer bei einer Vermietung erzielen könnte.
Diese Steuer wird nun gestrichen und dürfte beim aktuellen Zinsniveau zu Steuerausfällen führen. Steigt das Zinsniveau dereinst auf 2,5 bis 3 %, dann führt die Reform zu Mehreinnahmen. Zudem können Kantone eine Sondersteuer auf überwiegend selbstbewohnte Zweitliegenschaften einführen.

Kein Einbruch beim Hypothekenvolumen
Ein positiver Aspekt der Reform ist die Vereinfachung des Steuersystems. Denn nicht nur der Eigenmietwert ist bald Geschichte. Ebenfalls gestrichen werden Abzugsmöglichkeiten. Dabei handelt es sich einerseits um Schuldzinsen und andererseits um Liegenschaftsunterhaltungskosten. Weil Schuldzinsen nicht mehr von der Steuerschuld abgezogen werden können, sinkt der steuerliche Anreiz von Schulden. Die Hypothek zu reduzieren kann steuerlich sinnvoll sein.
Gemäss einer Umfrage, die Désirée Stähelin-Baldegger, Senior Kundenberaterin Finanzieren am acrevis Hauptsitz St.Gallen, im Zuge ihrer MAS-Abschlussarbeit bei Hypothekarkundinnen und -kunden der acrevis Bank durchgeführt hat, sehen 40 % eine Reduktion der Hypothek vor. Ein Drittel davon würde sie kurzfristig reduzieren, zwei Drittel mittel- bis langfristig. Die steuerlichen Anreize sind aber nicht der wichtigste Grund, der zu einer Reduktion der Hypothek führt. Häufiger genannt wurden in der Umfrage eine Reduktion der Verschuldung, wobei die Senkung der Zinskosten gleich relevant ist wie die steuerlichen Anreize.
Basierend auf dieser Umfrage ergibt sich mittel- bis langfristig eine erwartete Rückzahlung in der Höhe von 10 % des privaten Hypothekarvolumens für selbstgenutztes Wohneigentum. Eine Analyse von Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern kommt zum Schluss, dass die Abschaffung des Eigenmietwerts das Hypothekenwachstum lediglich bremst und zu Rückzahlungen des Hypothekarvolumens in den kommenden fünf Jahren in der Höhe von 3 bis 7 % führen. Ein Anteil des gesamten Hypothekarvolumens in der Schweiz entfällt auch auf Renditeobjekte und kommerzielle Immobilien, die von der Abschaffung nicht betroffen sind.

Ein kurzfristiger Boom bei Investitionen
So wie Schulden weniger attraktiv werden, sinkt auch der Anreiz für Liegenschaftsunterhaltkosten bei selbstgenutzten Immobilien. Können diese in Zukunft doch nicht mehr abgezogen werden. Anders sieht es bei Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen aus. Hier können auf kantonaler Ebene Abzugsmöglichkeiten eingeführt werden.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass mittelfristig die Investitionsausgaben sinken. Gemäss der Umfrage von Stähelin-Baldegger planen 20 % der Kundinnen und Kunden weniger zu investieren. Einbrechen dürften die Investitionen aber nicht. Wie Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, werden in selbstbewohnten Immobilien Investitionen auch ohne steuerliche Anreize getätigt. Selbstbewohnte Immobilien werden tendenziell auch besser erhalten als Mietobjekte.
Sehr wahrscheinlich ist, dass Investitionen vorgezogen werden. Dies haben 38 % in der Umfrage angegeben. Ein kurzfristiger Renovations-Boom ist dementsprechend wahrscheinlich. Dabei handelt es sich aber nur um eine Verschiebung des Investitionszeitpunktes, weswegen eine Baisse nach dem Boom ebenfalls wahrscheinlich ist. Gleichwohl ist es gut möglich, dass in dieser Boomphase die Preise für Investitionen deutlich ansteigen.

Das bedeutet das Ende des Eigenmietwerts
- Für bestehende Hypothekarkundinnen und -kunden: Eine generelle Handelsempfehlung kann nicht gemacht werden. Eine Rückzahlung der Hypothek kann steuerlich sinnvoll sein, muss aber nicht. Die finanzielle Situation muss in jedem Fall individuell angeschaut werden. Sicher ein guter Zeitpunkt für eine Aktualisierung der Finanzplanung.
- Für künftige Hypothekarkundinnen und -kunden: Nach einem Immobilienkauf bleibt in den ersten zehn Jahren ein beschränkter Abzug der Schuldzinsen bestehen. Davon profitieren erstmalige private Immobilienkäuferinnen und -käufer.
- Für den Immobilienmarkt: Die Immobilienpreise in der Schweiz sind in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen. Haupttreiber sind hier die niedrigen Zinsen sowie die Zuwanderung. Die Abschaffung des Eigenmietwerts steigert die Nachfrage nach Immobilien weiter, was ebenfalls eine preistreibende Wirkung haben dürfte. Überproportional teuer werden wohl Neuwertige Immobilien, wohingegen die Preissteigerung bei Altbauten unterproportional ausfallen dürfte.
- Für die Hypothekarzinsen: Entscheidend für den Hypothekarzins sind Marktfaktoren wie das allgemeine Zinsniveau, Objektfaktoren wie der Standort sowie individuelle Faktoren wie Bonität, Tragbarkeit sowie Laufzeit. Das Ende des Eigenmietwerts dürfte keinen nachhaltigen Einfluss auf die Hypothekarzinsen haben.
acrevis ordnet ein